Beendete Projekte
Übersicht
NA-48 ExperimentNA48-Projekt
- Beim NA-48 Projekt geht es primär um die präzise Bestimmung eines Parameters der CP-Verletzung (epsilon Strich) beim K-onen-System (K(long) und K(short)), der relativ empfindlich von dem top-masse-parameter abhängt.
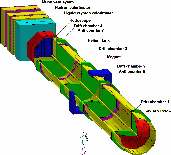 Zu diesem Behufe werden aus dem SPS kommende Protonen auf zwei Beryllium-Targets geschossen, was - neben "Müll" auch K(long) und K(short) erzeugt. Durch die geschickte Strahlaufteilung und Positionierung der Targets hat man eine möglichst große Ausbeute an K(long) und K(short) und kann beide in denselben Teilchendetektoren messen, was einen meßtechnischen Fortschritt gegenüber Vorgängerexperimenten darstellt, da systematische Fehler durch die Teilchendetektoren nun beide K-onen fast gleichermaßen betreffen.
Zu diesem Behufe werden aus dem SPS kommende Protonen auf zwei Beryllium-Targets geschossen, was - neben "Müll" auch K(long) und K(short) erzeugt. Durch die geschickte Strahlaufteilung und Positionierung der Targets hat man eine möglichst große Ausbeute an K(long) und K(short) und kann beide in denselben Teilchendetektoren messen, was einen meßtechnischen Fortschritt gegenüber Vorgängerexperimenten darstellt, da systematische Fehler durch die Teilchendetektoren nun beide K-onen fast gleichermaßen betreffen. Entscheidend für ein genaues Ergebnis sind die systematischen und statistischen Fehler - beide sollten so klein wie möglich sein. Durch hohe Erzeugungsraten und lange Beobachtungsdauer (d.h. in Summe viele Ereignisse) einerseits und durch genaue Detektorauflösung (sowohl zeitlich (Elektronik arbeitet im Gigahertzbereich!) als auch räumlich) andererseits wird dies ermöglicht. Wenn alles nach Plan verläuft, so wird der relevante CP-Verletzungsparameter auf 1% genau bestimmt werden.
Entscheidend für ein genaues Ergebnis sind die systematischen und statistischen Fehler - beide sollten so klein wie möglich sein. Durch hohe Erzeugungsraten und lange Beobachtungsdauer (d.h. in Summe viele Ereignisse) einerseits und durch genaue Detektorauflösung (sowohl zeitlich (Elektronik arbeitet im Gigahertzbereich!) als auch räumlich) andererseits wird dies ermöglicht. Wenn alles nach Plan verläuft, so wird der relevante CP-Verletzungsparameter auf 1% genau bestimmt werden.
Interessant ist vor allem die Klärung der Frage, ob dieser Parameter einen von Null verschiedenen Wert hat, was z.B. das Wolfensteinmodell der CP-Verletzung ausschlösse. Andererseits - wenn ein Wert nahe bei Null herauskäme, stellte sich im Rahmen des Standardmodelles die Frage, warum dieser Parameter Null sein sollte - es gibt dort nämlich keinen Grund dafür, und die Wahrscheinlichkeit für ein zufälliges Verschwinden eines reellen Parameters ist praktisch Null.
- Mein "Beitrag" zu diesem Projekt ist so bescheiden (2monatiges Monitoring von Trigger, Tagger und Clock sowie ein bißchen Softwareentwicklung), daß der Platz, der hier diesem Thema gewidmet ist eindeutig überdiemensioniert ist.
- Wieso ich trotzdem so ausführlich über dieses Projekt schreibe?
Der Aufenthalt am CERN war für mich so beeindruckend (weniger auf Grund der gigantischen Maschinen, die dort herumstehen oder der innovativen Soft- und Hardware, die dort entwickelt wird, sondern vielmehr auf Grund der Zusammenballung von tausenden von Wissenschaftern aus der ganzen Welt mit all ihren Konsequenzen), daß ich jedem Studenten empfehle, eine analoge Erfahrung (nicht notwendigerweise am CERN) zu machen.
- Es gibt für Studenten im Zweiten Studienabschnitt die Möglichkeit als Summer-Student über den Sommer am CERN zu arbeiten (empfohlen)!
Zurück nach oben
SToponium-Projekt
- Projekt-Nr.: 6465
Titel: SToponium Physics
Dauer: Juni 1997-Feburar 1998
Projektleiter: O.Univ.Prof. Dr.techn. Dipl.Ing. Wolfgang Kummer, Technische Universität Wien, Institut für Theoretische Physik
Kurzbeschreibung: Das minimal supersymmetrische Standardmodell - eine Erweiterung des phänomenologisch sehr erfolgreichen Standardmodells der Elementarteilchenphysik - postuliert die Existenz von Skalarteilchen, die analog zu ihren fermionischen Partnerteilchen Bindungszustände bilden können. Im Rahmen dieses Projektes wurde versucht, die theoretischen Aspekte der Beschreibung dieser Bindungszustände (z.B. SToponium als Partner-Bindungszustand zu Toponium) zu durchleuchten und eine Grundlage für Phänomenologie und Experiment zu bieten.
Kurzer Projektbericht: Im ersten Teil des Projektes wurde ein Arbeitsentwurf von Dr.techn. Dipl.Ing. Wolfgang Mödritsch zur theoretischen Beschreibung SToponiums analysiert [1]. Dabei wurde eine Diskrepanz zwischen dieser Arbeit und internationaler Literatur [2] entdeckt und aufgeklärt. Weiters wurden verschiedene Versionen der systematischen Störungstheorie auf ihre Brauchbarkeit für weitere Arbeiten untersucht und zusätzliche durch die Supersymmetrie implizierte Graphen auf Einschleifenniveau berechnet [3]. Im zweiten Teil wurden diverse vorbereitende Rechnungen für noch festzulegende größere Projekte dieses Fachgebietes angeführt. Dabei wurde grundlegenden Problemen - wie z.B. der systematischen Berücksichtigung des Confinements oder den nichttrivialen Implikationen die sich aus der großen Zerfallsrate des instabilen Bindungszustandes ergeben - besondere Beachtung zugewandt. Die Bedeutung dieser Ergebnisse für die theoretische Elementarteilchenphysik liegt in der systematischen Anwendung von störungstheoretischen Methoden bei Bindungszuständen von Skalarteilchen mit Hilfe der Bethe-Salpeter-Gleichung [4]. Für die experimentelle Hochenergiephysik sind diese Resultate zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht relevant, weil man im derzeit zugänglichen Energiebereich bis jetzt noch keine supersymmetrischen Teilchen entdeckt hat [5]. Allerdings sprechen mehrere phänomenologische und theoretische Gründe für eine Existenz dieser Symmetrie - wenn auch in gebrochener Form - und somit für eine Existenz der Bindungszustände, die wir beschrieben haben [6]. Die vorliegenden Resultate stellen eine wichtige Grundlage für weiterführende wissenschaftliche Arbeiten dar.
| Literatur: | |
|---|---|
| [1] | W. Mödritsch,On the Spectrum of Scalar-Scalar Bound States, Preprint TUW-96-05 W. Mödritsch,Phys. Rev. D56 (1997) 5386-5394 |
| [2] | D.A. Owen,On Quantum Electrodynamics of Two-Particle Bound States Containing Spinless Particles, 1993 |
| [3] | L. Widhalm,SToponium - Störungsrechunung für gebundene Zustände skalarer Teilchen im Hinblick auf Supersymmetrische Quantenfeldtheorie, Diplomarbeit, 1996; D.M.L. Grumiller ehem. Raunikar,SToponium - Massenkorrekturen zu O(  ) beim gebundenen STop-AntiStop-System, Diplomarbeit, 1996 ) beim gebundenen STop-AntiStop-System, Diplomarbeit, 1996 |
| [4] | E.E. Salpeter, H.A. Bethe,Phys. Rev. 84 (1951) 1232
M. Gell-Mann, F.E. Low,Phys. Rev. 84 (1951) 350 |
| [5] | Particle Data Group,Phys. Rev. D 54 (1996) 687 |
| [6] | z.B. M.E. Peskin,Beyond the Standard Model, European School of High-Energy Physics 1996 |
| Zurück nach oben | Zurück zur Physikseite |